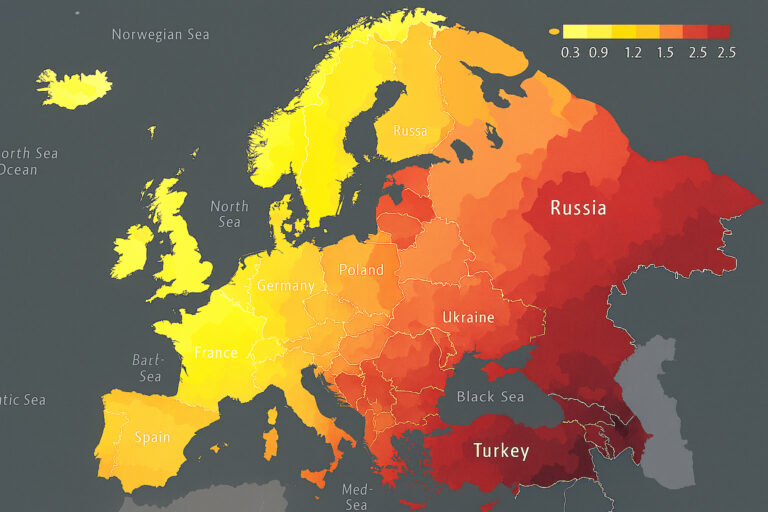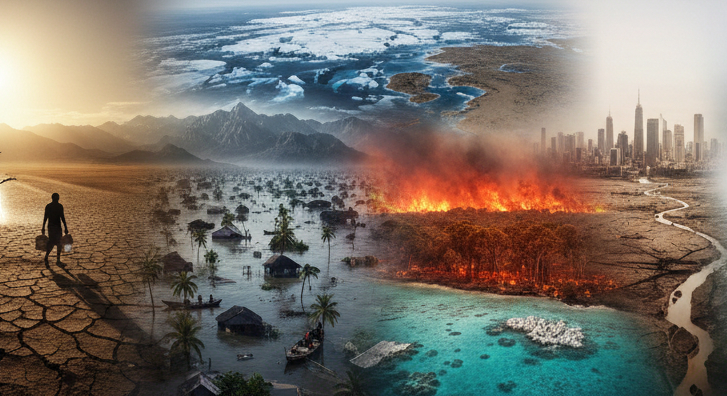Wetterprognosen – Wissenschaft im Dienste der Vorhersage

Die Grundlage jeder modernen Wettervorhersage bildet das Prinzip der numerischen Wettervorhersage, ein hochkomplexer, computergestützter Prozess, der auf den physikalischen Gesetzen der Atmosphäre beruht. Zunächst muss der aktuelle Zustand der Atmosphäre so präzise wie möglich erfasst werden; dies stellt den sogenannten Anfangszustand dar. Eine gigantische Menge an Messdaten strömt hierfür aus einem weltweiten Netz von Quellen zusammen. Dazu gehören konventionelle Messstationen am Boden, auf dem Meer treibende Bojen und Schiffe sowie Tausende von täglich aufsteigenden Wetterballons, die Temperatur, Druck und Feuchtigkeit in verschiedenen Höhen messen.
Einen unverzichtbaren Beitrag liefern zudem die Wettersatelliten, die aus dem Orbit kontinuierlich die Bewegung von Wolken und Wettersystemen beobachten und Infrarotdaten übermitteln. Selbst moderne Passagierflugzeuge übermitteln während ihres Fluges automatisch wichtige Messwerte in der oberen Troposphäre. All diese unorganisierten Rohdaten müssen in einem Schritt, der Datenassimilation, bereinigt, korrigiert und in das geordnete Schema der Modelle integriert werden, um eine konsistente Momentaufnahme der gesamten Lufthülle zu erhalten.
Um die Atmosphäre überhaupt berechnen zu können, spannen die Meteorologen ein dreidimensionales mathematisches Gitter um den Globus. Dieses Gitter besteht aus Abermillionen von virtuellen Würfeln, die die Atmosphäre horizontal und vertikal unterteilen, was man als Diskretisierung bezeichnet. Für jeden dieser Gitterpunkte werden die physikalischen Parameter des Anfangszustandes wie Temperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Feuchtigkeit und Strahlung gespeichert.
Nun beginnt die eigentliche Modellrechnung auf Hochleistungsrechnern, den sogenannten Supercomputern. In diesen Computern sind die fundamentalen hydrodynamisch-thermodynamischen Gleichungen der Physik hinterlegt, die beschreiben, wie sich die Wettergrößen aufgrund von Energie- und Impulserhaltung im nächsten kurzen Zeitschritt verändern werden. Diese Gleichungen sind nicht-linear und lassen sich nur iterativ numerisch lösen. Der Computer berechnet somit die Entwicklung des Wetters in unzähligen kurzen Schritten von wenigen Sekunden in die Zukunft, wodurch die Vorhersage Tag für Tag entsteht.
Da diese globalen Modelle aufgrund der Rechenleistung eine relativ grobe Gitterweite haben, nutzen Wetterdienste zusätzliche regionale Modelle mit einer viel feineren Auflösung für lokale Details. Die Ergebnisse der globalen Modelle dienen dabei als zwingende Randbedingungen für diese regionalen Modelle, die dadurch kleinräumige Phänomene wie die Entstehung von Gewittern oder Nebel präziser simulieren können.
Schließlich verwenden Meteorologen Ensemble-Vorhersagen, um die unvermeidbare Unsicherheit des chaotischen Systems Atmosphäre zu beurteilen. Dazu starten sie das gleiche Modell bis zu fünfzig Mal mit leicht unterschiedlichen Anfangsbedingungen. Die Streuung der resultierenden Prognosen zeigt an, wie wahrscheinlich eine bestimmte Wetterentwicklung ist und hilft dem Meteorologen, die endgültige, verständliche Vorhersage für die Öffentlichkeit zu formulieren, die damit auf einer soliden wissenschaftlichen Basis steht.
Die Schritte der Wettervorhersage
1. Datenaufnahme (Beobachtung)
Am Anfang steht die Erfassung des aktuellen Zustands der Atmosphäre. Hierbei werden verschiedene Wetterdaten an unzähligen Orten gemessen:
- Bodenmessstationen: Messen Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Niederschlagsmenge.
- Radiosonden/Wetterballons: Steigen auf, um Daten aus verschiedenen Höhen der Atmosphäre zu sammeln.
- Wettersatelliten: Liefern Bilder und Daten über Wolkenformationen, Temperaturen und Feuchteprofile aus dem Weltall.
- Weitere Quellen: Dazu gehören Messungen von Verkehrsflugzeugen, Wetterschiffen oder Bojen im Meer.
2. Datenverarbeitung und Modellierung
Alle gesammelten Daten werden in Supercomputer eingespeist.
- Dreidimensionales Gitternetz: Über die Erde und die Atmosphäre wird ein dreidimensionales Gitternetz gelegt. Für jeden Gitterpunkt wird der aktuelle Wetterzustand (Temperatur, Druck, Wind, Feuchte etc.) als Anfangszustand definiert.
- Physikalische Gesetze: In den Computermodellen sind die physikalischen Gesetze der Atmosphäre (zum Beispiel Bewegungsgleichungen und Energieerhaltung) in mathematischen Gleichungen hinterlegt.
- Berechnung: Der Supercomputer berechnet in kurzen Zeitschritten (z.B. alle paar Minuten) für jeden Gitterpunkt, wie sich der Zustand der Atmosphäre basierend auf diesen Gleichungen verändern wird. Dies ist die eigentliche Prognose für die Zukunft.
3. Meteorologische Interpretation
Die Ergebnisse der Computermodelle sind Rohdaten (z.B. vorhergesagter Luftdruck oder Wind).
- Ableitung: Meteorologen interpretieren diese Modellergebnisse, leiten daraus die eigentlichen Vorhersagen (Sonnenschein, Regen, Gewitterwahrscheinlichkeit) ab und erstellen Wetterkarten und Wetterberichte.
- Unsicherheit: Da die Atmosphäre ein chaotisches System ist (der sogenannte Schmetterlingseffekt), wächst die Unsicherheit der Vorhersage mit jedem Tag. Daher werden oft Ensemble-Vorhersagen erstellt: Man lässt das Modell mehrfach mit leicht unterschiedlichen Anfangsbedingungen laufen, um die mögliche Bandbreite der zukünftigen Wetterentwicklung abschätzen zu können.
Die Vorhersagequalität für die nächsten Tage ist heute sehr hoch, nimmt aber über einen Zeitraum von etwa 10 Tagen hinaus deutlich ab.
Wichtigste Globale Wettermodelle
Diese Modelle berechnen das Wetter für die gesamte Erde und dienen als Grundlage für alle weiteren Prognosen.
| Modell (Abkürzung) | Betreiber | Land/Organisation | Auflösung (typisch) |
| ECMWF (IFS) | Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage | Europa (international) | ≈9 km |
| GFS | Global Forecast System (NOAA/NWS) | USA | ≈13 km |
| ICON | Icosahedral Nonhydrostatic Model (DWD) | Deutschland | ≈13 km |
| UKMO (UM) | United Kingdom Met Office | Vereinigtes Königreich | ≈10 km |
| GEM | Global Environmental Multiscale | Kanada | ≈15 km |
| ARPEGE | Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle | Frankreich | ≈10 km |
| JMA | Japan Meteorological Agency | Japan | ≈20 km |
| ACCESS-G | Australian Community Climate and Earth System Simulator | Australien | ≈12 km |
Wichtig: Für eine zuverlässige Vorhersage vergleichen Meteorologen immer die Ergebnisse mehrerer dieser Globalmodelle. Das ECMWF gilt in der mittelfristigen Vorhersage (3–10 Tage) oft als das beste Modell.
Beispiele für Hochauflösende Regionalmodelle
Regionale Modelle („Limited Area Models“) decken nur einen bestimmten geografischen Ausschnitt ab (z. B. Europa), arbeiten dafür aber mit einer viel höheren Auflösung (kleinere Gitterweite), um lokale Phänomene (Gewitter, Starkregen, Windböen) besser zu erfassen.
| Modell (Abkürzung) | Fokus-Region | Auflösung (typisch) | Globales Basis-Modell |
| ICON-EU | Europa | ≈7 km | ICON (DWD) |
| ICON-D2 | Deutschland/Mitteleuropa | ≈2 km | ICON (DWD) |
| AROME | Frankreich/Westeuropa | ≈1.3 km | ARPEGE (Météo-France) |
| HARMONIE | Skandinavien/Niederlande | ≈2.5 km | International (HIRLAM-Konsortium) |
| NAM | Nordamerika | ≈12 km | GFS (NOAA/NWS) |
| HRRR | Kurzfrist-Modell (USA) | ≈3 km | GFS (NOAA/NWS) |
Warum so viele Modelle?
Die Vielfalt der Modelle ist notwendig, weil:
- Auflösung: Globale Modelle müssen kompromissbereit sein und können lokale Details nicht gut abbilden. Regionale Modelle („Nesting“) korrigieren dies mit einer viel feineren Gitterweite.
- Vergleich: Der Vergleich der Vorhersagen verschiedener Modelle (Ensemble-Vorhersagen) ist die beste Methode, um die Unsicherheit der Prognose zu quantifizieren.
- Forschung: Jedes nationale Zentrum verfolgt eigene Forschungsansätze zur Verbesserung der mathematischen und physikalischen Gleichungen in den Modellen.
Globalmodelle vs. Regionalmodelle
Der Hauptunterschied liegt im räumlichen Geltungsbereich und der Auflösung (Gitterweite).
| Merkmal | Globales Wettermodell (z.B. ECMWF, GFS, ICON) | Regionales Wettermodell (z.B. ICON-D2, AROME, GFS-NAM) |
| Geltungsbereich | Weltweit (Gesamte Erde) | Begrenzter Ausschnitt (z.B. Mitteleuropa, Nordamerika) |
| Auflösung (Gitterweite) | Groß (≈9 bis 20 km) | Fein (≈1 bis 7 km) |
| Vorhersagezeitraum | Langfristig/Mittelfristig (bis zu 10–16 Tage) | Kurzfristig (bis zu 1–3 Tage) |
| Stärken | Vorhersage von Großwetterlagen (Hochs, Tiefs, Jetstream-Lage). | Präzise Vorhersage lokaler Phänomene (Gewitter, Nebel, Starkregen). |
| Basis | Selbstständige Berechnung des Anfangszustands der Atmosphäre. | Benötigt die Ergebnisse eines Globalmodells als „Randbedingungen“ (Boundary Conditions) für den Rand des Modellausschnitts. |
1. Das Globalmodell: Der „Big Picture“ (Großwetterlage)
Globalmodelle sind dafür optimiert, die Bewegung großer Luftmassen und Wettersysteme über Tausende von Kilometern genau zu erfassen.
- Vorteil: Sie können die Entwicklung von Hoch- und Tiefdruckgebieten voraussagen, deren Zugbahn bestimmen und sind deshalb für die mittelfristige (3 bis 10 Tage) und langfristige Planung unerlässlich.
- Nachteil: Durch die größere Gitterweite (z.B. 10 km) können sie kleinskalige Effekte wie Berge, Täler oder lokale Gewitterzellen oft nicht präzise abbilden. Für sie sieht ein ganzes Gebirge oft nur wie ein großer Hügel aus.
2. Das Regionalmodell: Die „Lupe“ für lokale Details
Regionale Modelle werden durch den Prozess des „Nestings“ (Verschachtelung) in die Globalmodelle eingebettet.
- Vorteil: Dank der sehr hohen Auflösung (manchmal nur 1–2 km Gitterweite) können sie die Topografie (Berge, Küsten) genauer berücksichtigen und lokale Wetterphänomene wie:
- Die Entstehung von Gewittern und Schauern.
- Lokale Windsysteme (z.B. Föhn).
- Die genaue Position und Auflösung von Nebel oder Wolkenfeldern.
- Nachteil: Ihre Vorhersagegenauigkeit nimmt aufgrund des „chaotischen Systems“ der Atmosphäre sehr schnell ab, weshalb sie nur für die Kurzfristvorhersage (bis zu 48 Stunden) eingesetzt werden. Sie brauchen immer die Globalmodelle, um zu wissen, welche Wetterlage überhaupt in ihre Region hineinströmt.
Fazit:
Ein Meteorologe wird immer zuerst die Globalmodelle konsultieren, um die allgemeine Entwicklung der Woche zu bestimmen. Für die konkrete Vorhersage des Wetters morgen Mittag in einer bestimmten Stadt verwendet er jedoch die Ergebnisse der Regionalmodelle.