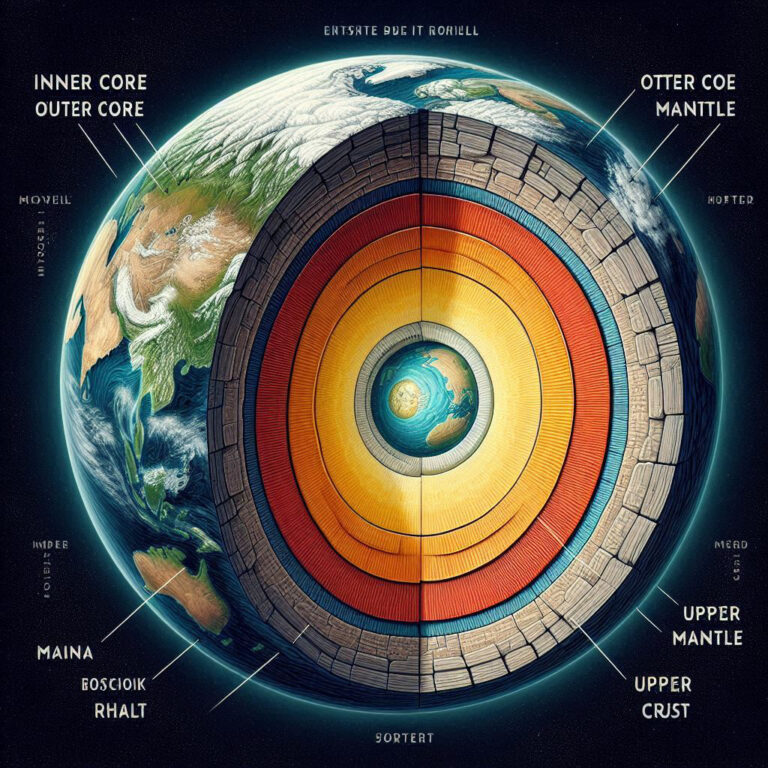Die Rolle von Korallenriffen als Indikatoren für Ozeantemperatur und Versauerung

Korallenriffe gehören zu den komplexesten und artenreichsten Ökosystemen unseres Planeten und werden oft als die Regenwälder des Meeres bezeichnet. Sie spielen eine entscheidende Rolle für die globale Biodiversität und den Schutz der Küstenlinien. Aufgrund ihrer festen, kalziumkarbonathaltigen Skelette sind Korallen einzigartige und präzise Bio-Indikatoren. Sie speichern chemische Informationen über ihre Umwelt, die Wissenschaftlern tiefe Einblicke in die historische Ozeanzusammensetzung ermöglichen.
Der bekannteste Mechanismus, der Korallen als Temperaturindikatoren auszeichnet, ist die Korallenbleiche. Steigen die Wassertemperaturen über einen kritischen Schwellenwert (typischerweise 1−2∘C über dem lokalen Maximum) über längere Zeit an, geraten die Korallen unter thermischen Stress. Als Reaktion darauf stoßen sie die in ihrem Gewebe lebenden symbiotischen Algen, die Zooxanthellen, aus.
Diese Algen sind nicht nur für die leuchtenden Farben der Korallen verantwortlich, sondern auch deren Hauptenergiequelle. Der Verlust der Zooxanthellen führt dazu, dass das Gewebe der Koralle transparent wird und das weiße Kalkskelett sichtbar wird. Diesen Zustand nennt man Bleiche, welche die Koralle stark schwächt und sie anfällig für Krankheiten macht. Anhaltende Bleichereignisse, wie sie durch marine Hitzewellen ausgelöst werden, führen unweigerlich zum Absterben großer Riffteile. Die Beobachtung der Bleichmuster und ihrer geografischen Ausdehnung liefert somit unmittelbare Daten über die thermische Belastung der Ozeane. Forscher nutzen Satellitendaten der Oberflächentemperatur, um die Bleichereignisse vorherzusagen und in Echtzeit zu verfolgen. Die Frequenz und Intensität der globalen Massenbleichen hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Dies bestätigt die Korallen als hochempfindliche Messinstrumente für die globale Erwärmung. Ohne die Korallenbleiche wäre das Ausmaß der thermischen Belastung weitaus schwerer zu visualisieren und zu kommunizieren.
Eine weitere zentrale Rolle spielen Korallen bei der Indikation der Ozeanversauerung. Durch die Aufnahme anthropogenen Kohlenstoffdioxids (\text{CO}_2) sinkt der pH-Wert des Meerwassers. Dieser Prozess reduziert die Konzentration von Karbonationen, die Korallen für den Bau ihrer Kalkskelette benötigen. Die Versauerung beeinträchtigt direkt den Prozess der Kalzifizierung und verlangsamt das Wachstum der Korallen. Jedes Korallenskelett besteht aus jährlichen Wachstumsringen, ähnlich den Jahresringen eines Baumes. Die chemische Zusammensetzung dieser Skelette dient als zuverlässiges Paläo-pH-Archiv. Das Verhältnis bestimmter Elemente und Isotope im Kalziumkarbonat korreliert direkt mit dem pH-Wert des Wassers zur Zeit ihrer Bildung. Durch die Analyse dieser chemischen Signaturen können Wissenschaftler die Versauerung des Ozeans über Jahrhunderte hinweg rekonstruieren. Sie ermöglichen es, die natürlichen pH-Schwankungen von den durch den Menschen verursachten Veränderungen zu unterscheiden. Besonders die Messung des Bor-Isotopenverhältnisses (δ11B) in Korallen ist ein etabliertes Verfahren zur Paläo-pH-Bestimmung. Die Korallen zeigen somit nicht nur die aktuellen Probleme an, sondern liefern den notwendigen historischen Kontext.
Die doppelte Bedrohung durch Bleiche und Versauerung macht die Korallen zu den wichtigsten Zeugen des Klimawandels im Meer. Sie integrieren die Signale der globalen Erwärmung und der erhöhten \text{CO}_2-Aufnahme in ihre Biologie und Struktur. Der rapide globale Riffverlust dient als deutliches Warnsignal für den katastrophalen Zustand der marinen Ökosysteme. Ihre Rolle geht über die eines passiven Indikators hinaus, da ihr Kollaps weitreichende Folgen für die Fischerei und den Küstenschutz hat. Der Schutz der verbleibenden Riffe ist daher nicht nur eine Naturschutzmaßnahme, sondern eine Priorität der Klimaanpassung. Korallenriffe sind somit essenziell, um die Geschwindigkeit und das Ausmaß der anthropogenen Meeresveränderungen zu verstehen. Ihre Gesundheit ist der barometrische Gradmesser für das gesamte globale Ozeansystem.
Korallenriffe als Klima-Indikatoren
I. Korallenriffe als Temperatursensoren: Der Mechanismus der Bleiche
Der Bleichprozess: Erklärung der Symbiose zwischen Korallenpolypen und Zooxanthellen (symbiotische Algen)
Korallenriffe sind komplexe Ökosysteme, deren Fundament auf einer entscheidenden Symbiose beruht. Die sesshaften Korallenpolypen beherbergen mikroskopisch kleine Algen, die sogenannten Zooxanthellen, in ihrem Gewebe. Diese Algen sind für die Polypen lebenswichtig, da sie mittels Photosynthese bis zu 90 Prozent der benötigten Energie liefern. Im Gegenzug bieten die Polypen den Algen einen geschützten Lebensraum und essenzielle Nährstoffe. Die Zooxanthellen sind zudem verantwortlich für die leuchtenden Farben, die gesunde Korallenriffe charakterisieren. Ohne diese symbiotische Beziehung ist die langfristige Überlebensfähigkeit der Riffbildner stark gefährdet. Diese physiologische Abhängigkeit macht die Korallen zu exzellenten Bio-Indikatoren für Veränderungen ihrer Umgebung. Nur das intakte Zusammenspiel dieser Partner gewährleistet das Wachstum der massiven Riffstrukturen. Die Störung dieser engen Verbindung ist der direkte Auslöser für das Phänomen der Korallenbleiche.
Thermischer Stress: Definition der kritischen Temperaturschwellen und der Dauer des Überhitzungsereignisses
Die symbiotische Beziehung zwischen Polypen und Algen ist extrem temperaturempfindlich und nur in einem engen Bereich stabil. Die kritische Schwelle für thermischen Stress liegt typischerweise nur $1^\circ\text{C}$ bis $2^\circ\text{C}$ über der lokalen maximalen Durchschnittstemperatur. Werden diese Schwellenwerte für einen längeren Zeitraum überschritten, beginnen die Zooxanthellen, toxische Sauerstoffradikale zu produzieren. Diese toxischen Verbindungen schädigen das Gewebe des Korallenpolypen und lösen eine Abstoßungsreaktion aus. Die Dauer des Überhitzungsereignisses ist dabei ebenso entscheidend wie die absolute Temperaturspitze. Ein kurzfristiger, sehr hoher Anstieg kann weniger schädlich sein als eine moderate, aber anhaltende Erhöhung über mehrere Wochen. Solche kumulativen thermischen Belastungen werden in der Forschung oft über „Degree Heating Weeks“ (DHW) quantifiziert. Die Sensitivität gegenüber bereits geringen Temperaturschwankungen macht die Korallen zu präzisen Thermometern der oberen Meeresschichten.
Visuelle Indikation: Beschreibung der Ausstoßung der Zooxanthellen und der Sichtbarkeit des weißen Kalkskeletts
Unter thermischem Stress stoßen die Korallenpolypen die gestressten Zooxanthellen massenhaft aus ihrem Gewebe ab. Dieser Verlust der Algen ist unmittelbar als Bleiche sichtbar, da die Koralle ihre Farbe verliert. Das nun transparente Korallengewebe legt das darunterliegende weiße Kalkskelett frei.
Das strahlende Weiß des freigelegten Skeletts dient als unübersehbares optisches Warnsignal für den kritischen Gesundheitszustand des Riffs. Obwohl die Koralle in diesem Zustand noch nicht tot ist, ist sie extrem geschwächt und kann keine Energie mehr aus der Photosynthese gewinnen. Sie beginnt, ihre Energiereserven aufzubrauchen und wird hoch anfällig für Krankheiten. Bleibt die Wassertemperatur zu hoch, stirbt die Koralle innerhalb weniger Wochen bis Monate ab, und das Riff beginnt zu zerfallen. Die visuelle Indikation der Bleiche bietet somit eine schnelle und intuitive Methode zur Bewertung der thermischen Belastung eines marinen Ökosystems.
Echtzeit-Monitoring: Nutzung der Bleichereignisse (Frequenz und Intensität) als direkter Beweis und Messgröße für marine Hitzewellen
Die Frequenz und Intensität der beobachteten Bleichereignisse dienen Wissenschaftlern als direkter, empirischer Beweis für die Existenz und Zunahme mariner Hitzewellen. Wenn Bleiche auftritt, registrieren Forscher sofort die genauen Koordinaten und die geschätzte Schwere des Ereignisses (Prozentsatz der betroffenen Korallen). Die globalen Massenbleichen, die in den letzten Jahrzehnten immer häufiger und ausgedehnter aufgetreten sind, korrelieren direkt mit der globalen Erwärmung. Durch die Verfolgung dieser Ereignisse können Forscher feststellen, welche Riffe besonders anfällig oder resilient sind. Diese Daten ermöglichen es, die Hotspots des Klimawandels in den Ozeanen präzise zu kartieren. Zudem liefert die Bleiche eine unmittelbare Messgröße für die ökologische Auswirkung thermischer Anomalien. Die steigende Frequenz der Bleichereignisse, die kaum noch Erholungsphasen zulässt, unterstreicht die dramatische Beschleunigung der Erwärmung.
Datenerfassung: Rolle von Satellitendaten zur Vorhersage und Verfolgung globaler Massenbleichen
Moderne Satellitentechnologie spielt eine unverzichtbare Rolle bei der Datenerfassung und der Vorhersage von Bleichereignissen. Satelliten messen kontinuierlich die Ozeanoberflächentemperatur (OST) in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Diese OST-Daten werden in Klimamodelle eingespeist, um potenzielle thermische Stresszonen zu identifizieren. Frühwarnsysteme wie das Coral Reef Watch der NOAA nutzen diese Daten, um Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit eines Bleichereignisses zu treffen. Wird die kritische Temperaturschwelle überschritten, werden Frühwarnungen an lokale Managementbehörden und Forscher ausgegeben. Dies ermöglicht eine zeitnahe Reaktion und das Monitoring der betroffenen Riffe vor Ort. Satelliten liefern somit das notwendige globale Bild, das durch lokale Tauchgänge verifiziert wird. Die Kombination aus Fernerkundung und In-situ-Daten ist für das Management und die Forschung von entscheidender Bedeutung. Diese technologische Fähigkeit hat die Korallenriffe zu den am besten überwachten marinen Ökosystemen gemacht.
II. Korallenriffe als Paläo-pH-Archiv: Die Versauerungsindikation
Die chemische Bedrohung: Erklärung der Ozeanversauerung durch die Aufnahme von anthropogenem Kohlenstoffdioxid
Die Ozeanversauerung resultiert aus der massiven Aufnahme von anthropogenem Kohlenstoffdioxid ($\text{CO}_2$) aus der Atmosphäre durch die Meere. Seit Beginn der industriellen Revolution hat der Ozean schätzungsweise ein Drittel des vom Menschen emittierten $\text{CO}_2$ absorbiert. Wenn $\text{CO}_2$ im Meerwasser gelöst wird, bildet es Kohlensäure ($\text{H}_2\text{CO}_3$), welche in Hydrogenkarbonat-Ionen und Wasserstoff-Ionen zerfällt. Die Zunahme der Wasserstoff-Ionen führt direkt zu einem Absinken des pH-Werts des Meerwassers. Obwohl der Ozean leicht alkalisch bleibt, wird dieser Prozess als Versauerung bezeichnet, da er saurer wird. Dieses Absinken des pH-Werts stellt eine fundamentale chemische Veränderung des marinen Milieus dar. Die Geschwindigkeit, mit der die Versauerung stattfindet, ist historisch beispiellos.
Kalzifizierungshemmung: Auswirkung des sinkenden pH-Werts auf die Verfügbarkeit von Karbonationen, die für den Skelettaufbau essenziell sind
Der sinkende pH-Wert hat eine unmittelbare und gravierende Auswirkung auf die Verfügbarkeit von Karbonationen ($\text{CO}_3^{2-}$). Karbonationen sind ein essenzieller Baustein, den Korallen benötigen, um Kalziumkarbonat $(\text{CaCO}_3)$ für ihre schützenden Skelette zu bilden. Mit abnehmendem pH-Wert verschiebt sich das Karbonat-Gleichgewicht, wodurch die Karbonationen knapper werden. Dies erschwert den Korallen den Prozess der Kalzifizierung, also den Aufbau ihres Kalkskeletts. Die Korallen müssen nun mehr Energie aufwenden, um die notwendigen Karbonationen aus dem umgebenden Wasser zu gewinnen. In stark versauerten Gewässern kann die Kalzifizierung vollständig zum Erliegen kommen oder sogar in eine Auflösung des Skeletts übergehen. Diese direkte Hemmung des Wachstums bedroht die gesamte strukturelle Integrität des Korallenriffs.
Wachstumsringe: Beschreibung der Korallen als chronologische Archive (vergleichbar mit Baumringen)
Massive hermatypische Korallen, wie zum Beispiel Porites, wachsen langsam und legen dabei dichte Kalkskelette an. Ähnlich den Jahresringen eines Baumes bilden diese Korallen unter periodischen Umweltbedingungen jährliche Wachstumsringe aus. Die Dichte und die chemische Zusammensetzung dieser Wachstumsringe variieren je nach den Umweltbedingungen des jeweiligen Jahres. Diese kontinuierlich abgelagerten Schichten bilden ein einzigartiges, hochauflösendes Paläoklima-Archiv. Durch das vorsichtige Entnehmen von Bohrkernen aus diesen massiven Korallen können Wissenschaftler jahrhundertelange Aufzeichnungen gewinnen. Diese Archive ermöglichen die Rekonstruktion präziser zeitlicher Reihenfolgen historischer Umweltveränderungen. Sie bilden damit die Grundlage für das Verständnis der natürlichen Variabilität des Ozeans.
Geochemische Analyse: Nutzung der chemischen Zusammensetzung des Kalkskeletts als Proxy für historische Umweltbedingungen
Das Kalkskelett der Korallen enthält neben Kalziumkarbonat auch Spuren anderer Elemente, deren Verhältnis zur Umgebungstemperatur und -chemie korreliert. Die Konzentrationen von Elementen wie Strontium (Sr) oder Magnesium (Mg) im Verhältnis zu Kalzium (Ca) dienen als Temperatur-Proxies. Entscheidend für die pH-Rekonstruktion ist jedoch die Analyse der chemischen Zusammensetzung der Skelette. Diese chemische Analyse ermöglicht es, die Versauerung des Ozeans über lange Zeiträume hinweg zu rekonstruieren. Durch die Kalibrierung dieser chemischen Signaturen mit modernen Messungen wird ihre Verlässlichkeit gewährleistet. Die Methode ist besonders wertvoll, da direkte pH-Messungen erst seit Kurzem systematisch erfasst werden.
Isotopenverhältnisse: Spezifische Rolle des Bor-Isotopenverhältnisses als verlässliches Paläo-pH-Messinstrument
Eine der zuverlässigsten Methoden zur Paläo-pH-Bestimmung ist die Analyse des Bor-Isotopenverhältnisses $(\delta^{11}\text{B})$ im Korallenskelett. Bor wird während der Kalzifizierung in das $\text{CaCO}_3$-Gitter der Koralle eingebaut. Das spezifische Verhältnis der Bor-Isotope $(\delta^{11}\text{B})$ hängt empfindlich vom pH-Wert des umgebenden Meerwassers ab. Dieses Verhältnis dient daher als direkter und präziser Proxy für den pH-Wert des Ozeans zur Zeit der Skelettbildung. Durch die Messung von $\delta^{11}\text{B}$ in den Wachstumsringen können Forscher historische pH-Werte rekonstruieren. Diese Daten ermöglichen es, die natürliche Variabilität des Ozean-pH-Werts von den durch den Menschen verursachten Veränderungen zu trennen. Die Bor-Isotopen-Methode hat maßgeblich zum Verständnis der Geschwindigkeit der aktuellen Ozeanversauerung beigetragen. Ihre Ergebnisse zeigen eine deutliche Abnahme des pH-Werts seit der industriellen Revolution.
III. Synthese und Ausblick: Der doppelte Alarm
Integrative Indikatoren: Korallen als Messinstrumente, die sowohl thermische (Bleiche) als auch chemische (Versauerung) Veränderungen integrieren
Korallenriffe sind einzigartige integrative Indikatoren, da sie nicht nur auf ein einzelnes Stressor reagieren. Sie zeigen thermische Veränderungen durch den gut sichtbaren Prozess der Bleiche an. Zugleich speichern sie die chemische Geschichte der Ozeanversauerung in ihren Wachstumsringen. Diese Fähigkeit, unterschiedliche Signale des Klimawandels gleichzeitig zu integrieren, macht sie unersetzlich. Die Kombination beider Indikatoren liefert ein vollständigeres Bild der maritimen Umweltkrise. Durch diese integrative Rolle werden komplexe, abstrakte wissenschaftliche Konzepte greifbar und messbar. Die Riffe agieren somit als ein umfassendes, biologisch verankertes Messsystem. Ihr Zustand spiegelt die Gesamtheit der anthropogenen Einflüsse auf die Ozeane wider.
Klimawandel-Zeugen: Die Riffgesundheit als barometrischer Gradmesser für den Zustand des gesamten globalen Ozeansystems
Der Zustand der Riffgesundheit dient Forschern als barometrischer Gradmesser für den allgemeinen Zustand des globalen Ozeansystems. Da Riffe an spezifische, stabile Umweltbedingungen angepasst sind, reagieren sie empfindlich auf jede Störung. Ihr Verlust signalisiert weitreichende Probleme, die weit über das Korallenökosystem hinausgehen. Der schnelle globale Riffverlust ist ein direkter Spiegel der Geschwindigkeit, mit der sich der Klimawandel vollzieht. Wo Riffe gedeihen, herrscht ein relativ intaktes und stabiles maritimes Gleichgewicht. Wo sie kollabieren, zeigt sich die Überlastung des Systems. Die Korallenriffe sind daher die „Kanarienvögel im Kohlebergwerk“ der Ozeane.
Ökologische Folgen: Die weitreichenden Konsequenzen des Riffverlusts für Biodiversität, Fischerei und Küstenschutz
Die ökologischen Folgen des Riffverlusts sind weitreichend und betreffen Millionen von Menschen. Korallenriffe bieten Lebensraum für schätzungsweise ein Viertel aller Meereslebewesen, weshalb ihr Kollaps einen massiven Verlust an Biodiversität bedeutet. Sie sind die Grundlage für die Fischerei vieler Küstengemeinschaften und tragen somit zur globalen Ernährungssicherheit bei. Darüber hinaus spielen gesunde Riffstrukturen eine entscheidende Rolle für den Küsten- und Erosionsschutz; sie agieren als natürliche Wellenbrecher. Der Verlust dieser Schutzfunktion macht Küstenregionen anfälliger für Stürme, Überschwemmungen und Erosion. Die wirtschaftlichen Verluste durch den Niedergang der Riffe im Tourismus- und Fischereisektor sind immens.
Notwendigkeit des Schutzes: Betonung der dringenden Notwendigkeit, Riffe zu erhalten, um das Ausmaß der anthropogenen Meeresveränderungen zu verstehen und zu bekämpfen
Die dringende Notwendigkeit, Korallenriffe zu schützen, geht über den Naturschutz hinaus. Riffe sind essenziell, um das volle Ausmaß und die Geschwindigkeit der anthropogenen Meeresveränderungen überhaupt verstehen zu können. Ihre Erhaltung gewährleistet die Kontinuität wichtiger historischer Klimaarchive. Effektiver Schutz umfasst die Reduktion lokaler Stressfaktoren wie Verschmutzung und Überfischung. Darüber hinaus sind globale Klimaschutzmaßnahmen zur Senkung der $\text{CO}_2$-Emissionen unerlässlich, um die Ursachen der Bleiche und Versauerung zu bekämpfen. Innovative Lösungen wie Riffrestaurierung und die Zucht hitzetoleranter Korallen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ohne globale Anstrengungen zur Reduzierung des thermischen und chemischen Stresses wird der Verlust der meisten Riffe unvermeidbar sein.
Schlussfolgerung: Die essenzielle, aktive Rolle der Korallenriffe als Frühwarnsystem für globale Umweltkrisen
Zusammenfassend spielen Korallenriffe eine essenzielle und aktive Rolle als Frühwarnsystem für globale Umweltkrisen. Ihre einzigartige Fähigkeit, thermische Schocks durch Bleiche visuell und chemische Veränderungen durch Skelettanalyse zu dokumentieren, ist wissenschaftlich unverzichtbar. Sie bieten nicht nur historische Kontexte, sondern liefern Echtzeitdaten zur Bewertung der aktuellen Meeresgesundheit. Die Riffe zwingen uns, die Geschwindigkeit der anthropogenen Störungen der Umwelt anzuerkennen. Ihr Schicksal ist untrennbar mit dem Schicksal des gesamten globalen Ozeans verbunden. Der Schutz dieser marinen Architekten ist daher eine Investition in die zukünftige Resilienz unserer Küsten und der maritimen Ökosysteme. Ihre schwindende Pracht mahnt zu sofortigem und entschlossenem Handeln.
Die größten Korallenriffe der Erde
1. Das Great Barrier Reef (Australien)
Das Great Barrier Reef ist das größte und komplexeste Korallenriffsystem der Welt und erstreckt sich über 2.300 Kilometer entlang der Küste Queenslands. Es ist von der UNESCO als Weltnaturerbe gelistet und beheimatet eine unvergleichliche Artenvielfalt, darunter 1.500 Fischarten und über 400 Korallenarten. Das Riff besteht nicht aus einer einzigen Struktur, sondern aus einem Netz von fast 3.000 einzelnen Riffen und über 900 Inseln. Trotz seiner Größe ist es durch den Klimawandel, insbesondere durch Massenbleichen, massiv bedroht. Seine immense ökologische Bedeutung macht es zu einem entscheidenden Barometer für die globale Meeresgesundheit.
2. Das Mesoamerikanische Riffsystem (Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras)
Dieses Riff ist das größte Transnationale Korallenriffsystem und das größte in der westlichen Hemisphäre, oft als MAR-System abgekürzt. Es erstreckt sich über fast 1.000 Kilometer von Yucatán bis zu den Bay Islands vor Honduras. Ein besonderes Highlight ist das Belize Barrier Reef, das zweitgrößte Einzelriff nach dem Great Barrier Reef. Das System umfasst viele verschiedene Lebensräume, darunter einzigartige Atolle und die berühmte Great Blue Hole. Es bietet kritischen Lebensraum für gefährdete Arten wie Seekühe und Meeresschildkröten.
3. Die New Caledonian Barrier Reef (Neukaledonien, Frankreich)
Das Neukaledonische Barrier Reef umschließt die Hauptinsel Grande Terre und ist eines der am besten erhaltenen und längsten durchgehenden Barriereriffe der Welt. Es erstreckt sich über etwa 1.500 Kilometer und bildet die zweitgrößte Riffstruktur weltweit nach dem australischen Pendant. Die Lagune von Neukaledonien gehört ebenfalls zum UNESCO-Weltnaturerbe und ist bekannt für ihre extrem hohe endemische Artendichte. Das Riffsystem beherbergt eine Population von Dugongs, die zweitgrößte der Welt, sowie zahlreiche einzigartige Fischarten. Aufgrund seiner isolierten Lage gilt es als eines der ursprünglichsten Riffsysteme und ist relativ widerstandsfähig gegen einige globale Bedrohungen.
4. Die Florida Reef Tract (USA)
Das Florida Reef Tract ist das einzige lebende Korallenbarriereriff in Nordamerika und das drittgrößte Riffsystem der Welt. Es verläuft in einem Bogen über 360 Kilometer entlang der Florida Keys, beginnend südlich von Miami. Das Riff unterstützt eine bedeutende Fischereiindustrie und ist eine wichtige Einnahmequelle für den Tourismus und die maritime Wirtschaft. Leider kämpft es intensiv mit der Korallenkrankheit Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD), die seit 2014 massive Schäden verursacht. Zahlreiche Wiederherstellungsbemühungen sind im Gange, um die Artenvielfalt und die Riffstruktur zu retten.
5. Das Red Sea Coral Reef (Rotes Meer, Ägypten, Saudi-Arabien, u. a.)
Das Rote Meer beherbergt ein langes, schmales Riffsystem, das sich über etwa 4.000 Kilometer erstreckt und für seine einzigartige Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Die Korallen in diesem Riff leben in wärmeren und salzigeren Gewässern als die meisten anderen, was sie hitzetoleranter macht. Dies macht das Rote Meer zu einem wichtigen Untersuchungsgebiet für die Klimawandelforschung und Rifferhaltung. Es ist berühmt für seine hohe marine Artenvielfalt und die exzellenten Tauchbedingungen mit steilen Riffwänden und Wracks. Die Riffe spielen eine kritische Rolle für die Küstenökonomie der angrenzenden Länder, insbesondere im Tourismussektor.